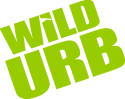|
Der Urb geht Wege, klettert über Mauern, überwindet Hindernisse. Der Urb ist ein Wilder und geht als solcher auch seiner Wege. Er findet neue Wege, nicht nur so grundsätzlich im Leben, sondern auch in der Liebe, im Denken und im Tun. Und dann stehen da Schilder. Mitten auf seinem Weg. So als ob ihm jemand einen Streich spielen wollte. Was soll das? Denkt sich dann der Urb.
Juristisch gesehen allerdings ist das so einfach dann nicht. Denn welche Wege darf man gehen und welche nicht? Was sagt das Wegerecht und wer macht es? Haben wir eigentlich ein Recht auf unseren Weg? Der Urb sagt: sicher, i deaf des! Aber was sagt der Jurist? Wir haben ihn gefragt. Hier ein spannendes Statement von Mag. Franz Galla... Wenn wir im Wald, am Berg oder auf den Wiesen unserer Wege gehen, fragen wir uns selten, ob wir überhaupt das Recht haben, uns gerade diesen Weg zu „nehmen“. Befinden sich Hundertschaften anderer Wanderer auf unserem Weg oder ist selbiger mit bunten Markierungen versehen, haben wir auch kaum Grund für den Zweifel an unserem Recht. Wer meint, dass die Frage, ob wir das alles auch wirklich dürfen, was wir in der Natur tun, könne ja nur einem Juristen einfallen, liegt richtig. Als solcher verfasse ich diese Zeilen, wobei meine Forschungen zu den diversen Wege- und auch Pflückrechten durchaus abwechslungsreich waren. WIE MAN IN DEN WALD HINEINGEHT Bewegen wir uns im Wald, so regelt das Forstgesetz österreichweit einheitlich die Nutzung desselben. Als Grundsatz gilt, dass jedermann den Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten darf. Ausnahmen bestehen etwa für Waldflächen mit ausdrücklichem Betretungsverbot, weiters für Flächen mit forstbetrieblichen Einrichtungen sowie für Wiederbewaldungs- und Neubewaldungsflächen. Diese Ausnahmen werden aber in der Regel gut ersichtlich gemacht sein. Eine über die Erholungszwecke hinausgehende Benutzung des Waldes, wie Lagern bei Dunkelheit, Zelten, Befahren oder Reiten, ist nur mit Zustimmung des Waldeigentümers bzw. Forststraßen-Erhalters zulässig. Das Abfahren mit Skiern im Wald ist im Bereich von Aufstiegshilfen nur auf markierten Pisten oder Schirouten gestattet. Schilanglaufen ohne Loipen ist unter Anwendung der nötigen Vorsicht gestattet; eine darüber hinausgehende Benützung des Waldes, wie das Anlegen und die Benützung von Loipen, ist jedoch nur mit Zustimmung des Waldeigentümers gestattet. Soweit es die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Wälder zulässt, hat der Erhalter einer Forststraße deren Befahren durch Fahrzeuge im Rettungseinsatz oder zur Versorgung von über die Forststraße erreichbaren Schutzhütten zu dulden. Neben dem gesetzlich geregelten Betretungs- und Aufenthaltsrecht zu Erholungszwecken besteht ein Gewohnheitsrecht des Inhalts, dass jedermann im Wald etwa Pilze und Bärlauch pflücken darf, soweit es dem Eigenbedarf dient. Eine gewerbliche Nutzung wäre nicht erlaubt. DIE GESETZE DER ALMEN UND BERGE Waren die Vorschriften den Wald betreffend einfach zu finden, weil es sich um ein Bundesgesetz handelt, sind die Vorschriften, insbesondere die Berge betreffend, für jedes Bundesland gesondert zu suchen. Einzelne Bundesländer haben ein eigenes „Gesetz über die Wegefreiheit im Bergland“ erlassen, das sind Salzburg, Kärnten und die Steiermark. Die Bestimmungen sind in den wesentlichen Punkten vergleichbar. Bestehende Wege (öffentliche Wege und Privatwege) im Bergland, welche dem Touristen- oder Fremdenverkehr zur Verbindung der Talorte mit den Höhen oder als Übergänge, Paß- und Verbindungswege bereits dienen, dürfen für diesen Verkehr nicht gesperrt werden. Privatwege, welche für den Touristen- oder Fremdenverkehr unentbehrlich oder zu dessen Förderung besonders wichtig sind, müssen diesem Verkehr geöffnet werden. Die jeweiligen Eigentümer der Privatwege trifft damit eine gesetzliche Pflicht, er darf aber eine angemessene Entschädigung von der öffentlichen Stelle verlangen. In diesem Sinne kann die Offenhaltung von Privatwegen über Verlangen des Grundeigentümers davon abhängig gemacht werden, dass die öffentliche Stelle bzw. der jeweilige Fremdenverkehrsverband die Erhaltung des Weges selbst besorgen, wenn er ausschließlich den Interessen des Touristen- oder Fremdenverkehrs dient. Der Touristenverkehr im Weide- und Alpgebiete oberhalb der oberen Waldgrenze ist laut den angesprochenen Gesetzen nur insoweit gestattet, als die Alp- und Weidewirtschaft dadurch nicht geschädigt wird, was die Agrarbehörde zu beurteilen hat. Das Alp- und Weidegebiet unterhalb der oberen Waldgrenze darf nur auf den allgemein zugänglichen Wegen betreten werden. Das Ödland oberhalb des Waldgebietes ist für den Touristenverkehr frei und kann von jedermann betreten werden. Ödland, welches in Verbauung oder Kultivierung gezogen wurde, darf hingegen nicht betreten werden. Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol haben vergleichbare Regeln in ihren Tourismusgesetzen vorgesehen. So regeln etwa das nieder- und auch das oberösterreichische Gesetz, dass Zugangswege zu Schutzhütten und sonstigen Touristenunterkünften, Stationen der Bergbahnen, Aussichtspunkten und Naturschönheiten (Wasserfälle, Höhlen, Seen und dergleichen) sowie die Aussichtspunkte und Naturschönheiten selbst dem Verkehr (aufgrund eines Bescheides) geöffnet werden müssen, soweit nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Dem Tourismus offene Privatwege dürfen nur solange und insoweit abgesperrt werden, als es wegen der persönlichen Sicherheit der Wegbenützer unerlässlich bzw. aus sonstigen öffentlichen Interessen unbedingt geboten ist. Im Tiroler Tourismusgesetz ist geregelt, dass zur Errichtung und Benützung von infrastrukturellen Anlagen, die für den Tourismus von besonderer Bedeutung sind, wie Schiabfahrten, Loipen, Übungsgelände für Schischulen, Sportplätze, Badeanlagen und Wege (Spazier-, Rad-, Mountainbike-, Wanderwege), und zur Schaffung von geeigneten Zugängen zu solchen Anlagen auf Antrag eines Tourismusverbandes Benützungsrechte durch Enteignung eingeräumt werden können. In Vorarlberg gibt es ein eigenes „Gesetz über den Bau und die Erhaltung öffentlicher Straßen sowie über die Wegefreiheit“: Die Eigentümer von öffentlichen Privatstraßen, die nach ihrer Art nur für den Verkehr von Fußgängern oder Tieren benützbar sind und vorwiegend dem Wandern dienen (Wanderwege), haben zu dulden, dass Gemeinden oder spezielle Organisationen diese Wege im bisherigen Umfang erhalten und an solchen Wegen Wegweiser und Markierungszeichen anbringen. Unproduktive Grundstücke, ausgenommen Bauwerke, dürfen von Fußgängern auch ohne Einverständnis des Grundeigentümers jederzeit betreten und zum Schifahren oder Rodeln benützt werden, soweit sie nicht eingefriedet oder nicht durch Aufschriften oder ähnliche Vorkehrungen als abgesperrt bezeichnet sind. Man kann also durchaus als Grundsatz formulieren, dass die freie Natur „bewandert“ werden kann, sofern nicht Zäune oder Hinweisschilder etwas anderes festlegen. WIEN IST ANDERS Bleibt noch Wien zu behandeln, wo neben dem verbauten Gebiet erfreulicher Weise recht viel Natur zu finden ist. Im Park von Schönbrunn und im Lainzer Tiergarten finden sich an den Eingängen Hinweise zu den Zeiten, an denen diese Anlagen zugänglich sind. Beim Lainzer Tiergarten haben sich die Besucher weiters mit der für sie geschaffenen Besucherordnung auseinander zu setzen. Man darf dort nämlich nur die ausgewiesenen Wege und Lagerwiesen betreten, weil sonst etwa die rund 700 Mufflons oder die anderen Wildtiere gestört würden. In Wien ist auch manches erlaubt: So kennt der Normenbestand der Gemeinde Wien eine Verordnung, die das Rodeln und Schifahren in den diesbezüglich gekennzeichneten Bereichen in explizit genannten Parks bis zum Einbruch der Dunkelheit erlaubt, wie etwa im Draschepark (4. Bezirk), im Waldmüllerpark (10. Bezirk) oder am Roten Berg (13. Bezirk). Andererseits gibt es Verbote, die auch geübte Wiener kaum kennen dürften: So ist auf der im 17., 18. und 19. Wiener Gemeindebezirk gelegenen Höhenstraße ist das Reiten und das Gehen in der Längsrichtung verboten. Die bertreffende Verordnung des Magistrates ist aus 1961 und verbietet auch das Reiten in darin konkret bezeichneten Verkehrsflächen im 17. und 19. Bezirk. Ein Verbot besteht auch im Bereich der Regulierungsanlagen des Wienflusses: Zwischen dessen Mündung in den Donaukanal bis zur Querung beim Hackinger Steg ist das Betreten des Flussbettes, der Mauern, Böschungen, Abfahrtsrampen, Abgangsstiegen und Rettungsleitern sowie das Befahren der Abfahrtsrampen und des Flussbettes mit Fahrzeugen nicht gestattet. Wer den Verboten zuwiderhandelt, begeht zumindest eine Verwaltungsübertretung und muss bis zu € 700,00 Strafe zahlen. Besondere Erwähnung verdient die Wiener Grünanlagenverordnung. Laut dieser ist es verboten, ohne Zustimmung der Anlagenverwaltung Feuerstellen (z.B. für Grill- oder Kochzwecke) anzulegen oder zu unterhalten, Grill- oder Kochgeräte in Betrieb zu nehmen, zu kampieren, Eis zu laufen oder in Wasserflächen zu baden. Weiters dürfen Grünflächen weder betreten, noch befahren, noch zum Abstellen von Fortbewegungsmitteln benützt werden. Vom Betretungsverbot ist jedoch das Liegen und Verweilen in Rasenflächen zum Zwecke der Erholung tagsüber ausgenommen, sofern auf diesen nicht gleichzeitig Pflege- oder Instandhaltungsmaßnahmen stattfinden. Die Befahr- und Abstellverbote erstrecken sich nicht auf das Schieben von Fahrrädern, auf das Befahren solcher Flächen mit Rollstühlen, fahrzeugähnlichem Kinderspielzeug und mit Kinderwagen und deren kurzfristiges Abstellen. Warum man in Parks keinen Flieder pflücken darf, regelt auch die Grünanlagenverordnung: Schädigende chemische, mechanische oder sonstige Einwirkungen auf Pflanzungen jeder Art (Blumen, Bäume, Sträucher und dergleichen), soweit sie nicht gärtnerischen Gestaltungsmaßnahmen des Grünanlagenerhalters dienen, sowie jede Beeinträchtigung ihres Lebensraumes sind verboten. Was den Bärlauch betrifft, der in den Wiener Wäldern wächst, belässt wohl die gewohnheitsrechtliche Pflückerlaubnis, die generell in Wäldern gilt, die vielen pflückenden Wiener und Wienerinnen straffrei. Im Lainzer Tiergarten wird man sich aber meist schwer tun, zum Bärlauch zu gelangen, wenn man die Wegebenutzungsvorschrift achten will. Solange aber keine Wildschweinfrischlinge verschreckt werden, wird der Lainzer Förster wohl seine Augen zudrücken, wenn die Scharen an Bärlauch-Liebhabern die bachnahen Waldflächen vom Knoblauch-Hauch befreien, damit er fortan die Küchen und Wirtshäuser bevölkern mag. Da nicht erforscht ist, ob die Wildschweine aromatischer schmecken, wenn sie große Mengen an Bärlauch vertilgen, besteht kein ausgewiesenes Interesse der fortbehördlichen Tiergartenaufsicht, den Bärlauchbestand besonders zu schützen. Links:
WildUrb trifft den FM4-Moderator Martin Blumenau im Burggarten, der dort jeden einzelnen Stein mit Namen kennt und selbst und ganz persönlich die Burggartenbewegung miterlebt hat. Warum er gerne geht und vor allem, was es ihm bringt zu Fuß zu gehen, das erfahren wir im Interview. Und wenn wir schon dabei sind, machen die Urb`s gleich einen Streifzug durch die Grünoasen des ersten Hiebs...
WildUrb trifft den FM4-Moderator Martin Blumenau im Burggarten, der dort jeden einzelnen Stein mit Namen kennt und selbst und ganz persönlich die Burggartenbewegung miterlebt hat. Warum er gerne geht und vor allem, was es ihm bringt zu Fuß zu gehen, das erfahren wir im Interview. Und wenn wir schon dabei sind, machen die Urb`s gleich einen Streifzug durch die Grünoasen des ersten Hiebs (für unösterreichische Urb`s ist damit der erste Bezirk gemeint). Im Track »Oide G`schichten« haben wir den »ersten Hieb« als ein kräftig pochendes Herz voller Regsamkeit und Leben beschrieben, ein Stadtteil in dem der Urb –fußgängertechnisch – auf seine Kosten kommt. Doch mit einem kann dieses Herz schlecht umgehen – mit Veränderung. Es ist klar, dass der größte Teil des Charmes den dieser Stadtteil versprüht, die monumentalen, historischen Bauten sind und das soll auch so bleiben. Aber was ist mit den Erholungsorten? Da wuselt ein Urb den ganzen Tag auf zwei Beinen durch Gassen, sieht am Ende seiner Tour die herrlichen Wiesen von Volks- und Burggarten oder Theresien- und Heldenplatz und möchte sich natürlich sofort ausruhen, denn so ein Stadtbummel hat es ja bekanntlich in sich. Aber da sind diese Schilder. Betreten verboten – oder gar ein »durchgestrichenes Mensch« Bildchen, stecken fest im Erdboden. Zusätzlich schleichen Ordnungshüter herum um die ganz mutigen Wiesenbegeher zu vertreiben. Dabei sind Grünflächen – im Gegensatz zu den starren Gebäuden – Leben. Also genauso wie der Mensch dem natürlichen Rhythmus der Veränderung unterworfen. Einige Bewegungen haben schon versucht die Wiesen von ihren Piktogrammen zu befreien, aber das Wiener Herz blieb kalt. Der Grund sollen die hohen Kosten der Reinigung sein. Da fragt sich halt der Urb, warum die eingesetzten Ordnungshüter nicht zu Lehrern umfunktioniert werden, die denjenigen die noch immer nicht begriffen haben, dass die Natur ihren Müll absolut nicht brauchen kann, eine weise Einschulung gibt. Nichts desto trotz sind es wunderschöne Erholungsplätze und mit einem Quäntchen Hoffnung, das die »durchgestrichenen Menschen« Schildchen bald verschwinden mögen, haben die Urbs diese Innenstadt-Oasen unter die Lupe genommen. Gleich vorweg: Ich warte an Ampeln. Meistens. Doch ich wollte einmal ausprobieren wie es ist, nicht zu warten. Als gesetzestreuer URBsie jedoch (aber vor allem wegen der Vorbildfunktion und wegen der Kinder, die auch an Ampeln warten) wollte ich nicht über rote Ampeln marschieren. Also was tun? Ich habe mich entschieden mich von den Ampeln leiten zu lassen. Ich nahm mir vor, geradeaus zu gehen und abzubiegen, sobald ich an eine grüne Ampel kam. Weiters wollte ich an T-Kreuzungen ohne Ampel, die Richtung durch Münzwurf bestimmen und auch immer auf der Straßenseite bleiben, auf die mich der Zufall, eine Fußgänger-Umleitung oder Ähnliches führte. Als Zeitlimit setzte ich mir eine Stunde und war schon ganz gespannt, wo ich landen würde.
Ich stieg also bei der U6-Station Josefstädter Straße aus und begab mich zu dem Ausgang, von dem aus ich meinen üblichen Weg nehmen würde. Die Ampel war grün und statt jetzt links zu gehen, querte ich den Gürtel und ging die Josefstädter Straße stadteinwärts. Die nächste Ampel an der Kreuzung Albertgasse war zwar grün, doch die gerade aus der Station fahrende Straßenbahn versperrte mir den Weg und als sie vorbei war, war es die Ampel zur Albertgasse, die grün war – ein Wink des Schicksals? Also die Albertgasse runtergehen. Ziemlich unspektakulär geht es eine Weile dahin, bis zur Kreuzung Lerchenfelder Straße. Dort wende ich mich nach links, so wie es die Ampel mir vorgibt. Eigentlich würde ich mir gerne die Auslage des Erotik-Shops ansehen, doch leider bin ich auf der anderen Straßenseite gelandet. Meinen Weg fortsetzend kam mir der Gedanke einen Sprung in das Spielzeuggeschäft zu machen, das ich öfter mal besuche, doch das Schicksal wollte es anders und schickte mich die Kellermanngasse hinunter. Ganz schön steil, hoffentlich muss ich dort nicht wieder rauf. Doch zu früh gefreut, gleich nach Überquerung der Neustiftgasse stieg die Kirchengasse an. Vorbei am kleinen, aber feinen, Off-Theater gelangte ich zur Burggasse, wo mich die Ampeln nach links lenkten. Die Ampel zur Stiftgasse war rot, also ging ich weiter die Burggasse hinunter, bis mich das grün durch die Breite Gasse zog und weiter in die Karl-Schweighofer-Gasse. Diese trifft auf die Mariahilferstraße und ich bekam zum ersten mal die Gelegenheit die Münze entscheiden zu lassen. Kopf – rechts, Zahl – links. Es kam Kopf, und ich marschierte die MaHü stadtauswärts weiter. Dann etwas Kurioses: alle Ampeln waren rot! Da ich aber nicht warten wollte, bog ich rechts in die Stiftgasse ein und folgte dieser mangels wegweisender Ampeln weiter bis zur Burggasse, wo mich die selbe Ampel, die mich vorhin weitergehen ließ, links und damit wieder stadtauswärts lockte. Die Ampeln der Kreuzung Burg- und Kirchengasse waren wieder rot in alle Richtungen (das dürfte ein lokales Phänomen in Neubau sein) und ich ging links die Kirchengasse hoch. Gerade als ich mir überlegte, ob ich denn nicht am Siebensternplatz ein kleines Päuschen einlegen sollte, meldete sich der Timer – die Stunde war vorbei und ich stand vor dem Haus Kirchengasse Nummer 40/2. Was mir das Schicksal damit sagen wollte? Ich habe keine Ahnung! Text: M. Steinweg Wien liegt ja bekanntlich an einem Fluss, dem bei richtiger Belichtung durchaus blauen Donaustrome. Aber eben nicht wirklich. Und das ist schade. Denn was ist schöner, als ein eine Stadt teilendes Gewässer, an dessen Gestade man flanieren, sitzen, trinken oder speisen kann. Fast jede Stadt von Rang hat das, nur eben Wien nicht. Das einzige was dieser beeindruckende Strom teilt, ist Cis- von Transdanubien. Auch das mag seine Reize haben, aber auf der Donauinsel dahin zu latschen, ist einfach nicht das selbe, wie am Seineufer abendliche Romantik zu erleben oder die Donau in der Budapester Innenstadt genießen zu können.
Wien stattdessen hat den Donaukanal, wie sich dieses Gewässer, das den 1. vom 2. Bezirk trennend, rinnsalend dahintümpelnd großspurig nennt. Kanäle haben es üblicherweise an sich, dass sie von Schiffen und Booten befahren werden, Leben und Getriebe auf ihnen herrscht, doch bis auf ein traurig bemaltes, mit güldnen Kugeln verunziertes "Hundertwasser Schiff" bewegt sich auf diesem schmutzig grauen Gewässer um diese Jahreszeit nichts. Stattdessen liegen rostende und ausgebrannte Kähne vor Anker - morbider Charme, wie er nur in Wien zu finden ist. Ich gehe gerne, und zwar alleine. Und gerade im Winter suche ich bisweilen Orte auf, welche sommers nur so vor Leben strotzen. Denn bei all den gescheiterten Versuchen, dem Donaukanal und seinen Ufern so etwas wie urbanes Flair einzuhauchen, sind diese Unterfangen bisher nie wirklich geglückt. Und gerade das macht winters für mich den Reiz dieses graubraunen Gewässers aus. Kaum ein Stadtteil unserer sonst so liebenswert seltsamen Stadt ist missglückter als der Kai und die Obere Donaustraße. 50er Jahre Häuserabscheulichkeiten gliedern sich nahtlos an von lieblosen Architekten hingezeichnete Bürotürme, und das dazwischen liegende, an das düstere Mausoleum eines größenwahnsinnigen Potentaten gemahnende Sofitel runden das Bild einer der tristesten und doch wunderbaren Gegenden der Wiener Innenstadt ab. Selbst die neu errichtet Anlegestelle des feinen Twin City Liners, der Wien mit Bratislava verbindet und das sehr erfreuliche „Motto am Fluss“ beherbergt, hätte man in der kommunistischen Slowakei der 50er Jahre kaum passender gestalten können. Und dazwischen liegt eben dieses von mir so geschätzte Rinnsal, der Donaukanal. Vom Schwedenplatz die wunderschönen Jugendstiltreppen hinabsteigend, eröffnet sich mir, dem fröhlichen Misanthropen, ein Bild winterlicher Tristesse, die mir den Uranerz-Klumpen, der einst aus dem Permafrostboden von Krasnokamensk gebuddelt, statt eines schlagenden Herzens in meiner Brust, harte Gamma-Strahlung gegen die Menschheit schleudert, vor Freude im Leibe springen lässt! Alles da unten ist sehenswert! Beginnend beim Badeschiff, das sommers von fröhlich sonnenhungrigen Menschen bevölkert wird und jetzt nicht mehr ist als ein winterlich trauriger Kahn, der allerdings auch das großartige Holy-Moly beherbergt, in dem sich zu verhältnismäßig günstigen Preisen Haubenküche genießen lässt. Es ist einsam hier unten zwischen den von Graffiti gezierten Mauern und dem schwerfällig dahinziehenden Gewässer. Gut so. Denn mein Weg soll ein einsamer sein. Ein weiteres Highlight donaukanaliger Tristesse ist das seit Jahren vor Anker liegende, ausgebrannte Wrack des ehemaligen Partybootes Búho Verde, das sich zu entfernen Gott Lob bisher noch niemand entschließen konnte. So reihen sich rostend, trauriger Kahn an Kahn bis man die in ihrer Einsamkeit grotesk wirkende Summerstage erreicht. Wo im Sommer das Leben pulst, ist hier derzeit bestenfalls auf vereinzelte Jogger zu treffen. Ein morbider Hochgenuss! Aber wer diese Einsamkeit genießen will, muss sich beeilen! Der Frühling nähert sich mit Riesenschritten und dann ist’s vorbei mit Tristesse und Monotonie, dann wird hier wieder geradelt und geschwätzt. Die Lokale wachsen aus dem Boden, Sand wird ausgebracht um Strandstimmung zu verbreiten. Kurz das Leben kehrt zurück und das ist schließlich auch nicht schlecht. Text: F. Stampach Ich treffe mich mit Philippe Andrianakis im Stadtpark. Hier ist sein emotional Place, sein WildPlace, wie wir URBs zu sagen pflegen. Hier ist es so herrlich romantisch meint er, er wäre ja im tiefsten Inneren seines Herzens ein Romantiker. Und weil Philippe (so wie ich) in Graz in die Ortweinschule gegangen ist und dort Bildhauerei studiert hat, schätzt er die Arbeit der Bildhauer und Architekten des alten Wiens in diesem Park besonders.
Philippe ist der junge Mann, der vor gut einem Jahr von Bregenz nach Wien GEHgangen ist. Für eine T-Mobil Kampagne. NEIN! Gegen Aids und für mehr Aufklärung über diese stigmatisierende und tödliche Krankheit. Der 20-jährige Philippe Andrianakis wanderte also binnen sechs Wochen - vom 30. Mai bis 4. Juli 2010 von Bregenz nach Wien. Heute vor einem Jahr und 7 Tagen kam er in Wien an. Ich will wissen, was ihn damals bewegt hat und was aus seiner Idee: Gehen für den guten Zweck geworden ist. Ich frage mich nämlich schon die ganze Zeit, warum wir nach der T-Mobil Kampagne nichts mehr von Philippe gehört haben. Schade eigentlich. Schade, dass gute Inhalte, die die Werbung hochspielt immer kurzlebiger und oberflächlicher werden. Das soll aber in keinster Weise die Leistung von Philippe schmälern. Im Gegenteil: von Bregenz nach Wien zu Fuß zu gehen – ja, das wissen die URBs – ist eine geniale Sache. Ich weiß auch, diese lange Strecke zu gehen ist kein „Bemmerl“. Selbst bin ich in 4 Tagen von Perchtoldsdorf nach Mariazell gegangen. Als ich mir einbildete, ein Spaziergang alleine sei zu wenig, um auf irgendetwas Sinnvolles draufzukommen, ging ich nach Mariazell. Nicht wegen der Kirche dort, die war mir egal, aber der Weg war gut beschrieben. Ich ging los, die Füße taten mir weh, aber der Kopf war so herrlich frei. Ich war frei. Am ersten Tag nach 10 Stunden Fußmarsch dachte ich, ich könnte nie wieder einen Schritt tun. Doch in der Früh stellst du dich auf deine beiden Beine und gehst weiter. Am dritten Tag begann es zu regnen und mir war klar, dass ich nicht umdrehen würde. Am vierten Tag bin ich in Mariazell angekommen und war enttäuscht, weil der Weg zu Ende war. Ich habe erkannt, dass das Sinnvolle am GEHEN ist, dass du merkst, es geht immer weiter, egal wie weh die Füße tun, egal wie schwierig alles gerade scheint. Es ist wie im richtigen Leben. Wieviele Schritte mögen das wohl gewesen sein? Von Bregenz nach Wien. Vom einen Ende zum anderen Ende Österreichs. Was war die Zündung für seine Idee? Philippe erzählt mir, dass er seinen Zivildienst in Graz bei der Aidshilfe gemacht hat. Dort wurde ihm erst so richtig bewusst, wie schrecklich isolierend und ausgrenzend diese Krankheit ist. Wenn du Krebs hast, dann bemitleiden sie dich wenigstens, wenn du Aids hast, hast du und bist du nichts mehr. Dagegen wollte Philippe ein Zeichen setzen, sich für mehr Aufklärung vor allem bei den jungen Leuten einsetzen. Und als die Kampagne startete, waren wir alle neugierig. Ob er es schafft? Ob er durchhält? Und er hat durchgehalten. Auch wenn viel Handywerbung im Vordergrund stand, auch wenn die Knie unendlich wehtaten, auch wenn heute die Website über das Projekt stillgelegt ist, deine zigtausend Fans erinnern sich an dich und deinen Weg. Kannst stolz sein auf dich Philippe! Ehrlich. Aber wer ist der Mensch Philippe Andrianakis eigentlich? Ein kreativer Geist, ein Romantiker, einer der Visionen hat und sich nicht scheut auch einmal über den Tellerrand zu schauen und Dinge zu tun, die andere so schnell nicht tun würden. Einer der seine Freundin liebt und das auch sagen kann. Einer der in Wirklichkeit gar nicht so gern zu Fuß geht. Geht’s uns nicht allen ein bisschen so? Mir schon. Aber wenn ich es doch tu, geht’s mir gut. Lasst´s es euch gut GEHEN! LINKTIPPS Jakobs- und andere Weitwanderwege in Europa, http://www.alpenverein.at/weitwanderer/Weitwanderwege/Fernwanderwege/ Pilgercommunity, http://www.pilgern.at Pilgern in Österreich, http://www.pilgerwege.at/cms/index.php?page_new=2 Philippe Andrianakis auf Facebook Gregor Sieböck, http://www.globalchange.at |
Kategorien
Alle
|