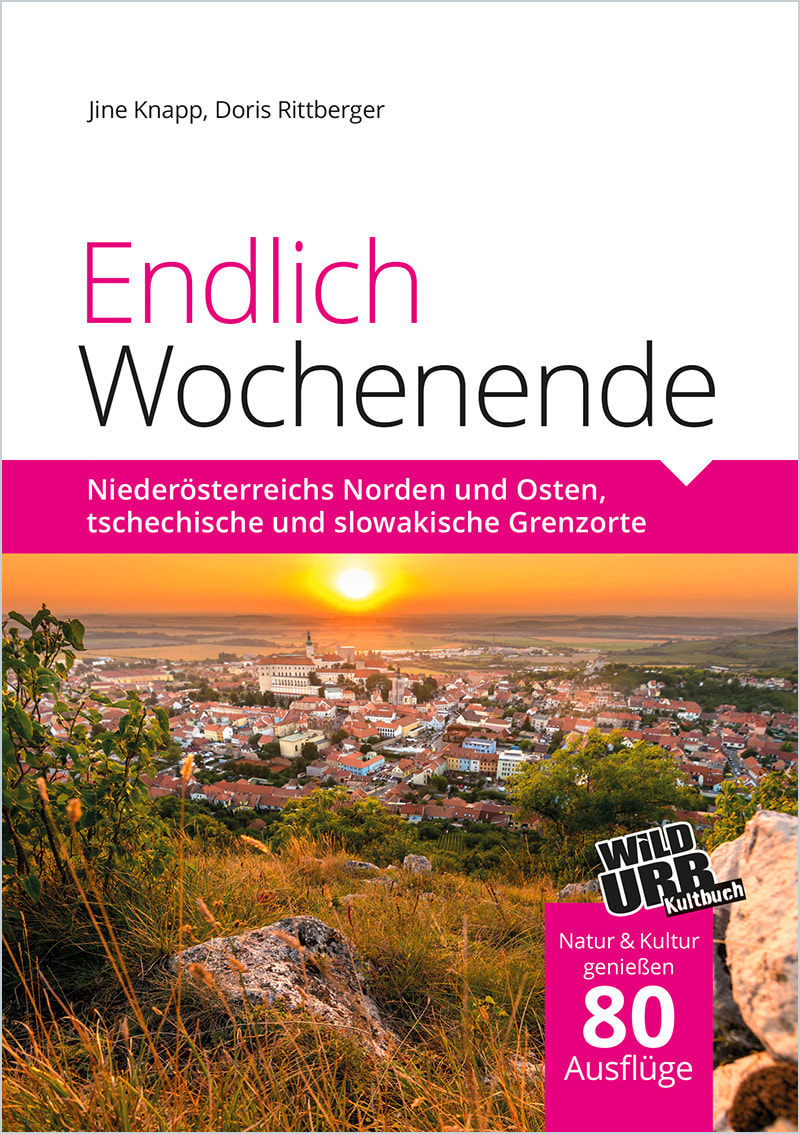|
Letztes Wochenende war ich wieder einmal auf der Perchtoldsdorfer Heide. Üblicherweise fahre ich die Lohnsteinstraße hinauf und parke am Parkplatz oben an der Bergstraße. Einen Parkplatz zu finden ist gar nicht so einfach, denn wie meistens an Sonntagen, hatten auch schon andere vor mir die originelle Idee ihren Sonntagnachmittag hier zu verbringen. Ich gehe den Schleichweg seitlich bergauf, also nicht die sich nach oben schlängelnden Serpentinen entlang, sondern kreuze die Asphaltstraße und wandere querfeldein. Das hat den Vorteil, dass man direkt über Trockenrasen geht und sich der Boden unter den Füßen wie ein Teppich anfühlt. Wie ein mit Schafsbemmerl übersäter Teppich, weil gerade wieder eine Schafsherde auf der Heide weilt. Ich gehe also Direttissima bergauf, weiche gekonnt den Ziesellöchern aus, bleibe kurz am ersten Drittel stehen, um mich umzudrehen und die Aussicht über Wien auf mich wirken zu lassen, denn dies nicht zu tun, wäre ein Faux pas, und wandere weiter entlang des ausgetretenen Pfades, bis ich wieder an der Asphaltstraße ankomme und dieser vorbei am Kinderspielplatz Richtung Parapluiberg folge. Besonders gerne höre ich dabei Hörbücher. Mit Köhlmeiers Roman Abendland im Ohr genieße ich den Tannennadelduft in der Nase und den Waldboden unter den Füßen. Nach etwa 20 Minuten oder mehr, so genau kann ich das nicht sagen, weil ich total in die Geschichte versunken bin, die mir diesmal leider nicht Köhlmeier selbst vorliest, gelange ich an die Wegkreuzung, die mich fragt, ob ich zum Salzstanglwirt abbiegen oder weiter zur Kammersteinerhütte gehen will. Ich entscheide mich für ersteren und biege rechts ab. Ich setze mich draußen an einen der freien Tische, weil innen kein Platz frei ist und während ich auf die Kellnerin warte, steht er plötzlich vor mir: Walter. Er sieht mich freundlich lächelnd an und streckt mir seine Hand, die er vorher von seinem Handschuh befreit hat, zum Gruße entgegen. „Grüß dich, ich bin der Walter,“ sagt er und ich sehe die rosaroten Wangen, seine Freundlichkeit in den Augen und das leichte Schmunzeln, dass sich um seine Mundwinkel kräuselt. Ich strecke ihm meine Hand hin und er drückt sie, nicht unangenehm fest, wie es manchmal Leute tun, wo man gleich aufspringen möchte, sondern mit angenehmer Festigkeit, nicht zu viel und nicht zu wenig, angenehm, respektvoll, herzlich. „Das ist schön, dass du da bist,“ sagt er, „und dass du so lieb lachst, das ist auch schön. Es gibt nämlich so viele Menschen, die schauen so zwieda drein, das ist gar nicht schön. Aber du, du schaust freundlich und lachst, das gefällt mir.“ Und dann erzählt er mir, dass er 87 Jahre alt ist und jedes Wochenende hierherkommt und er fragt mich, wie ich heiße. „Doris,“ sag ich. „Die Doris, also,“ sagt er und grinst mit seinen rosaroten Wangen. „Auf der Siebener-Stiege, bei mir zuhause in Wien im Wohnhaus am Kahlenberg, da wohnt eine Dorli,“ redet er weiter. Und dann streckt er mir wieder die Hand hin, als hätten wir uns ewig nicht gesehen und er tut das so, wie wenn man sich begrüßt, weil man sich so richtig von Herzen freut, einen lieben Menschen getroffen zu haben und es gerade nichts Schöneres gibt auf der Welt, als diese Begegnung und er sagt: „Alles Gute Doris, alles, alles Gute.“ Dann lässt er meine Hand wieder los, zieht sich den Handschuh an und geht. Am Retourweg denke ich mir, wie schön das war, Walter getroffen zu haben und dass ich ihn mag. Er sitzt nicht nur herum und tut sich leid oder schimpft auf die Welt, sondern geht hinaus und wo hinauf und dann wieder hinunter und er redet mit den Leuten und freut sich, wenn wer lacht, weil er selber gerne lacht. So einfach ist das. Für alle, die Walter auch einmal begegnen möchten: Der Wanderweg "Verborgene Reize" ist übrigens in unserem Buch WIEN GEHT von Jine Knapp beschrieben. NEUES BUCH FÜR NOCH SCHÖNERE Wochenenden!
Die Frage warum Menschen gehen, beschäftigt mich immer wieder. So auch in diesem heutigen Beitrag. Nun das Gehen, die ursprünglichste alle Fortbewegungsmöglichkeiten des Menschen, ist allseits bekannt. Aber warum gibt es Menschen die wirklich sehr viel gehen? Also ich spreche hier von mehreren hunderten Kilometern. Menschen, die ihre „daily dosage“ an Gehen benötigen, um "ganz" zu sein.
Als passionierte Geherin habe ich in den letzten Jahren einige „Hardcore- Geher“ kennengelernt. Es sind Menschen, für die das Gehen mehr als nur Fortbewegung ist und ich möchte Euch nun einen kleinen Einblick in ihre/unsere Welt ermöglichen. Da ist Christian, ein Bauunternehmer, er hat das Gehen für sich als Burn-Out-Prävention entdeckt und war in den letzten Jahren schnell und weit unterwegs. Mittlerweile ist er eher langsam unterwegs, mal über die Alpen, mal bei 100km Wanderungen. Martin - er hat das Gehen zu seinem Beruf gemacht und schreibt Wanderführer. Immer auf der Suche nach neuen Routen und Wegen, die noch nicht so bekannt sind, abseits des Mainstream. Und Peter, der am Weg nach Mariazell „erleuchtet“ wurde und seitdem immer weiter, höher, schneller und mehr geht. Er nimmt an Ultrawanderungen teil und macht Solo-Wanderungen. Er berichtet darüber in seinem Blog. Michaela hat nach schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen das Gehen für sich entdeckt und ist seitdem eine leidenschaftliche Geherin. Sie sucht beim Gehen nach kreativen Lösungen für ihr berufliches Umfeld. Harald geht für sein Leben gern und in Zeiten besonderer Herausforderungen war intensives Gehen für ihn oftmals eine Hilfestellung. Er geht gerne alleine und in Gemeinschaft, aber immer öfter in Stille. Stefan ist bereits als Kind viel hochgebirgs- weit- und flurgewandert. Dass ihm diese Mühsal später einmal gefallen würde, hätte er nicht gedacht. Wirbelsäulenschmerzheilungsbedingt (ist fast das Wort des Jahres 2016 geworden) geht er schleichend wie ein Indianer. Es ist sehr wichtig, dem Gehen einen gebührenden Raum im Leben zu geben, wir sind darauf geprägt, wir Menschen, und sollten wohl mit dieser Art von Fortbewegung einen guten Teil unsere Zeit verbringen, damit es uns gut geht. Kerstin aus Stuttgart wandert gerne, mal schnell und weit, mal langsam und bedächtig. Zur Zeit eher langsamer unterwegs, da sie nach einigen 24Stunden-Wanderungen die Lust am Kilometer-sammeln verloren hat. Darum genießt sie nun wieder mehr und ist gern auch mehrtägig mit Übernachtung unterm Sternenhimmel unterwegs. Thorsten - für ihn ist die Bewegung und die Begegnungen, die Erlebnisse, der Aufenthalt in der Natur von großer Bedeutung. Es ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die das Gehen für ihn zu einer substanziellen Sache machen. Das zur Ruhe kommen, das Entspannen. Es ist für ihn ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil seines Lebens. Er geht von Bahnhof zu Bahnhof, von Stadt zu Stadt. Ich selbst gehe seit 6 Jahren sehr viel, für mich ist GEHEN nach einem Autounfall mein Sport, ich gehe täglich mindestens fünf bis zehn Kilometer und wenn ich längere Zeit nicht gehen kann, werde ich ziemlich unrund. Für mich ist GEHEN Psychohygiene, Entschleunigung. Beim Gehen kann ich denken oder mich einfach wegbeamen und manchmal fehlen mir auch kurze Teilstrecken, weil ich in mir versunken war. An anderen Tagen nehme ich alles um mich herum viel intensiver wahr, erfreue mich an meiner Umgebung, an einem Grätzl, dass ich grad entdeckt hab, an Menschen oder Tieren, welche mir begegnet sind. Es gibt hundert verschiedene Gründe, warum wir gehen. Wichtig ist nur, dass wir es tun! In Wien oder in Berlin oder wo auch immer. Gerade erschienen: BERLIN WANDERT > hier GEHTs zur Leseprobe! Text: ©BellaDraxler |
Kategorien
Alle
|